
Vergangenheit, Jetzt. Fiktion und Wirklichkeit.
Manches so, als wär es nie gewesen.
Rohre, Rätsel, Überraschungen. Es dreht sich.
Ulrike Draesner
»Alles Schwindel«
Fotos: Tobias Bohm
Sie möchten sich bewegen? Ich setze Sie in eine Kugel und für Augenblicke geht es im Kreis, bis Ihnen fast schwindelig wird! Vor und zurück, Vergangenheit und Jetzt. Dinge sehen, die man gar nicht mehr sieht. Aber ja: deswegen lesen Sie hier. Schwindel ist für Berlin ideal.
Wesen mit Herzen, Wesen wie Mäuse, Hasen, Hunde oder Menschen, können offensichtlich nicht anders als Höhlen zu bauen. Dort wohnen sie dann. Wie das geht – und warum es so schwierig ist, mit Bauwerken zu lügen, obwohl man sie oft nur baut, um zu lügen, schaut diese Tour sich an. Bankamöbe, Fernsehturm, Lehrerfries. Am Ende: Baumkuchen. Welch Gebäude. Verzückte Japanerin fragt: warum hat in Bellin alles ein Loch?
Mein Berlin?
Welch Euphemismus!
Doch Sätze dieser Art tun uns gut – „mein Mann“, „mein Auto“, „meine Stadt“. In Wirklichkeit geht es so: ich sitze im Flugzeug, unter uns erscheint Berlin, es schnellt etwas nach mir aus, kassiert mich ein. Und ich freue mich, habe dieses Grinsen im Gesicht, wenn ich durch den rührend kleinen Flughafen Tegel gehe, der Busfahrer mich anraunzt, wobei er seinen Berliner Schnauzbart bewegt und aussieht wie eine gestrandete Robbe.
Das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten (MfAA)
war das Außenministerium der DDR.
Das Hochhaus stand bis 1996 in Berlin-Mitte
unmittelbar neben der Friedrichswerderschen Kirche.
Bertelsmann Repräsentanz
Kommandantenhaus
Unter den Linden 1
10117 Berlin
Wasserturm Prenzlauer Berg
Ältester Berliner Wasserturm (1877 erbaut und bis 1952 in Betrieb).
Er steht zwischen Knaackstraße und Belforter Straße im Kollwitzkiez.
Berlin als Rebhuhn, wer glaubt das schon
1995, als ich fünf Monate am Wannsee verbrachte, bestand Berlin aus S-Bahn-Fahrten, Baustellen und ratternden Gleisen, als hole ständig jemand schwer Atem, ein mechanisch-stählerner, doch alter Körper, man wollte Öl hineintropfen, mit einem Zehn-Liter-Kanister Olivenöl S-Bahn fahren und die Berliner Türen schmieren, das rote Blinken, das eigene Staunen: mitten in dieser Stadt steht ein Wald.
Andere Städte haben Häuser, Berlin hatte Wald, Wasser, Löcher, gab sich als Rebhuhn, flach, geduckt, auf Feld und Sand. Rohre und Straßenschilder wuchsen an unvermuteten Stellen aus dem Boden, wenn man nicht aufpasste, lief man dagegen. Wege waren krumm, Wurzeln schossen an der Oberfläche dahin, und stand endlich einmal ein Haus so herum, dass ich es erkannte, wuchtig wie etwa das DDR Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten, gleich an der Spree neben dem Grundstück, auf dem sich heute die Bertelsmann Repräsentanz erhebt – also, stand ein solches Riesenhaus endlich im Weg, 145 Meter lang, 44 Meter hoch, ein massiger Riegel, Stahl mit Vorhängungen, Lisenen aus Alu, weiß, etwas wirklich Unübersehbares – stand es am Abend selbstsicher im Licht – und war am nächsten Morgen weg.
Ab Sommer 1996 wohnte ich in Prenzlauer Berg, und das war wirklich nicht der Berg, den man heute dort vorfindet. Nackt, graubraun, kohlig, abgeschabt. Bestattungsunternehmer und wahnsinnig schnell eröffnende und wieder schließende Blumenläden, ein Bäcker, ein Platten-Kaiser’s, der Rest garantiert geschäftefrei, zum Käsekaufen fuhren wir, ich gebe es zu, manchmal nach Westberlin.
Ich komme aus einer bergigen Gegend und brauchte gute drei Jahre um zu bemerken, dass der Prenzlauer Berg nicht in Prenzlau liegt, sozusagen als Ziel, sondern dass ich darauf wohnte. Ja, dies Hügelchen! Obenauf stand statt eines Hauses ein Kanister, diesmal nicht für Öl, sondern für Wasser. Sozusagen natürlich, also berlingemäß, war er leer. Neben dem Kanister Wasserturm stand ein zweiter, geformt wie ein Rohr, und streckte sich zu den bekannten Berliner Wolken, ganz wie es einen Kilometer entfernt das dritte große östliche Stadtrohr vormachte, der
Berliner Fernsehturm
Panoramastr. 1A
10178 Berlin
S- und U-Bahn Alexanderplatz
info@berlinerfernsehturm.de
Eintrittspreise:
Erwachsene: 10.00 €; VIP-Ticket: 19.50 €; Kinder bis 16 Jahre: 5.50 € ; Kinder bis 3 Jahre: frei; Gruppenpreis pro Person: (nur bei schriftlich bestätigter Reservierung und ab 20 zahlenden Gästen) 8.00 €
Tischreservierungen Telecafé unter: 030/ 24 75 75 875
Öffnungszeiten:
März bis Oktober tägl. von 9 Uhr bis 24 Uhr
November bis Februar tägl. von 10 Uhr bis 24 Uhr
Fernsehturm
Berlin hat weder überall Häuser noch hat es Häuser von Anfang an. Es lohnt sich, einmal um seinen Rand zu fahren, Gras Gras Gras, flache öde dürre Pampa und – plopp – ein gelbes Schild: „Berlin“.
Dahinter der Fernsehturm. Auch er kein Haus, sondern ein Rohr mit Antenne, 368 Meter hoch. Sehen Sie nur, wie der Stiel sich nach oben verjüngt, auf welcher Höhe die Kugel schwebt, wie die Proportionen miteinander spielen. Korrekt heißt das so: „Schaft 250 Meter, siebengeschossige Turmkopfkugel mit Telecafé auf drehendem scheibenförmigem Ring“. Da fühlt man, wo man ist: Technik und Sprache der 60er Jahre.
Fällt nachmittags Sonnenlicht auf die Restaurantkugel, trägt der sozialistische Prestigebau ein Kreuz. Es ist weiter zu sehen als je ein Kreuz von einem Kirchturm strahlte. „Kreuz des Ostens“, sagte man mir, habe es von Anfang an geheißen. Die Schlangen vor dem Turmlift sind in der Regel kürzer als jene am Reichstag. Und man kommt höher hinaus. Die Einrichtung des Cafés lohnt ebenfalls, vor ein paar Jahren wurde sie originalgetreu wieder hergestellt. Und so rotiert man nun hier in der Höhe langsam vor sich hin. Freier Blick rundum – auf das grüne, wässrige, sandige, lückige, rutschende Berlin.



Hochhaus auf der nördlichen Seite des Alexanderplatzes
Zitate aus Alfred Döblins „Berlin Alexanderplatz“ (1929), der als erster und bedeutendster deutscher Großstadtroman gilt.
Am ehemaligigen Haus der Elektroindustrie wurden die grünen Glasplatten zwischen den Fensterreihen durch hellgraue Aluminiumplatten ersetzt. Auf jede wurde ein Buchstabe gedruckt.

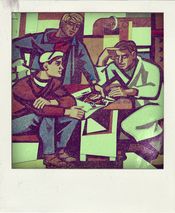
Haus des Lehrers
Alexanderstraße 9
neben der Kongresshalle, die heute das Berliner Congress Center (bcc) beheimatet
Webseite800.000 harte Stücke
An der Ostseite des Alexanderplatzes stehen auf den Plattenbaufassaden Sätze aus Alfred Döblins Berlinroman, die erzählen, wie Anfang des 20. Jahrhunderts vor Ort die U-Bahnschächte ausgehoben wurden. Kaum war die Stadt vereinigt, wurde wieder sehr viel gegraben. Und wenig geölt. Stellen Sie sich im Bahnhof Alexanderplatz die Glasüberdachung mit kaputten Scheiben vor, stellen Sie sich Winter vor, Sibirien, und Sie ahnen etwas von der Berliner Luft.
Ich lief und fuhr als Gast durch Berlin. Am Potsdamer Platz war die Straße, die ich am Morgen mit dem Fahrrad genommen hatte, auf dem Rückweg verschwunden, Barrieren und Boxen wuchsen aus dem Sand, Richtungen drehten sich, bis ich nicht mehr wusste, wo mir der Kopf stand. Im Volkspark Friedrichshain spielten ab achtzehn Uhr Kinder, sie waren 15 Jahre und älter, spielten mit Flaschen und Hasch, mit Strichen und der Dunkelheit der Bäume, die zurückfiel auf uns, die Fremden, die Zugereisten, wie man dort, wo ich herkam, zu solchen sagen würde, wie ich es jetzt war, in Berlin.
Welch Segen, dass es das Haus des Lehrers gab.
Man erkennt es mühelos, eckig und gerade, dieses erste Hochhaus der DDR, ein Lehrer mit Bauchbinde. Sie besteht aus einem Fries, einer Art Film, der sein Thema Unser Leben ganz lehrerhaft, sozusagen für Staatskinder, erklärt. Entwerfen und ausführen lassen durfte ihn Walter Womacka. Kleinstarbeit auf 125 x 6,80 Metern, fertig gestellt 1964. Manchmal, wenn ich dort vorbeifahre, stelle ich mir vor, wie die Arbeiter in blauen Anzügen an der Fassade stehen und Steinchen sortieren, auf Gerüste klettern, mit einem Steinchenladen vorm Bauch, und keine 1.000 Meter weiter liegen die Steine der Mauer ebenfalls noch ganz frisch aufeinander.
Inzwischen hat der ehemalige Klassenfeind die Bildergeschichte vom glücklichen Aufbau der DDR restauriert, Soldat und Arbeiterin, Wissenschaftler und Politkopf, in 800.000 harten Stücken aneinander gesetzt. Die Mauer ist fort, wie jeder weiß, aber läuft man durch Berlin, meint man manchmal, sie für Sekunden in verwandelter Form doch noch stehen zu sehen. Gut fürs Nachdenken. Wie hier.
Hinter dem Fries, dieser Binde oder Augenbinde, lag einst die Lehrerbibliothek. Und eben hier beginnt das Haus eine Geschichte zu erzählen, von der man unmöglich gewollt haben kann, dass es sie erzählt. Immer wieder ergeht es mir so mit Häusern in Berlin. Haus des Lehrers: ein „Bücherspeicher“ hinter einem Fries, also ohne Fenster, damit man nicht hinausschauen kann? Und nicht hinein. Traurig genug, möchte man meinen, und mit der ersten Erklärung fortgehen. Aber wenn Sie das Haus aus etwas größerer Entfernung betrachten, werden Sie erkennen, wie geräumig der Speicher ist und wie sehr er das Haus bestimmt. Also doch ein Schatz, ein Giftschrank, der von hinten durch den Fries und dessen sozialistische Menschen strahlt, ein großer verborgener Kasten aus Buchstaben, der Unser Leben heimlich fütterte und anleuchtete und infizierte.
Da spricht das Haus. Da gefällt es mir, ambivalent in seiner Form und Bildbotschaft, in allem, was der gebaute Stein über das Gewollte hinaus, bis heute erzählt.
House of Fiction
Hier hat es für mich angefangen, „mein Berlin“: dass sich, wenn man Lügen baut, und das tut man immer, wenn man mit einem Bauwerk etwas beweisen will, auch das Gegenteil zeigt.
Häuser erstellen einen Raum, etwas, das den kleineren Raum ‚Körper’ umfängt, das ihn fest- oder aufhält, schützt oder sperrt. Ein Haus zu bauen heißt, Grenzen zu errichten, ein Außen und Innen zu schaffen und sich in vielfachen Brechungen fortsetzen zu lassen, als Inneres des Äußeren, als innerste Wand der Außenwand vor der Außenseite der nächsten Innenwand und so fort.
Wesen mit Herzen, Wesen wie Mäuse, Hasen, Hunde oder Menschen, können wohl nicht anders, als Höhlen zu bauen. Ihre Herzen, geteilt in Kammern, liegen in Häuten, von einem Beutel umschlossen, der aus zwei Stoffen besteht, damit sie aneinander gleiten. Auch hier werden ständig innen und außen umeinander gefaltet und auseinander hervorgestülpt.
So hat es angefangen oder mich eingefangen, Berlin mit seinen Häusern und ihren Löchern, seinen Tunneln, Röhren und Rohren. Es fing an, mir zu zeigen, wie etwas sich umstülpt und noch einmal das Umgestülpte umstülpen kann, ein Handschuh, so oft gewendet, dass etwas Neues entsteht.
Henry James, ein amerikanischer Schriftsteller, dessen Texte häufig in Europa spielen, spricht im Vorwort eines seiner Romane vom House of Fiction. Als Autor oder Leser stehe man dort mit einem Fernrohr am Fenster und blicke hinaus auf die „human scene“. Das Fenster rahmt den Blick, man sieht einen Ausschnitt, es gibt zahlreiche – endlose – andere Fenster in diesem Haus.
James’ Bild ist gut, also lässt es sich ausdehnen: man kann das Schreiben eines Romans als Bau solch eines house of fiction verstehen. Alles muss man herstellen, die Räume und die Szenerie draußen, das Fernrohr dazulegen, einen Eingang, eine Fassade, alles Innere, Überraschung und Spannung in der Bewegung, wo sind Übergänge, Stockwerke, da geht es eine Wendeltreppe hinauf, dann steil nach unten, auf einen Balkon. Mehrere Figuren bewegen sich zugleich in diesem Gebäude, das doch erst mit ihrer Bewegung entsteht.
Gebaut werden ein Innen und Außen, das sich vielfach spiegelt und wiederholt. Man springt ja gerade um diese Grenze, wenn das Erzählen von einer Figur zu einer anderen führt, der Figur in Kopf und Herz schaut, wenn man das Subjekt wechselt, das Thema, seine Freiheit der Erfindung und Regie nutzt. Freiheit ist das eine; das andere sind die Gesetze, denen man folgt. Man braucht Grenzen und Übergänge, um ein Gebäude zu schaffen, das sich begreifen lässt, eines ist und doch unterschiedliche Zimmer und Atmosphären kennt. Einen Roman bauen wie ein Haus – „nur“ ohne Schwerkraft im üblichen Sinn. Sie muss und kann neu erfunden werden, das Steigen und Fallen von Räumen, die man nicht erwartet hat, von Räumen wie geträumt.
Geldhaus mit Amöbe
In Berlin gibt es Häuser, die mir dies zeigen, sie erinnern daran, wie es sich von innen anfühlt, einen Roman aufzubauen – eine Architektur zu erfinden nach den Gesetzen der Grammatik, der literarischen Tradition und der eingesogenen, wahrgenommenen, übersetzten „Wirklichkeit“ – und doch überraschend zu sein, lesbar und schön, schwindelig auch, sanft, mitleidlos, eigen.
Wenn Sie am Pariser Platz stehen, und dort werden Sie stehen, Sie können dort gar nicht nicht vorbeikommen, um es auf James’sche Weise zu sagen, gehen Sie links zwischen der Akademie der Künste und der Amerikanischen Botschaft in eine Bank.
Passend, nicht wahr, eine Bank am Brandenburger Tor? Der rechte Ort für Überraschungen jedenfalls: Geld taumelt und ist, wovon viele Menschen sich heutzutage am allerliebsten in Taumel versetzen lassen. Leg deine Wange an mich, sagt der schöne Schein.
Von außen ist das Gebäude der DZ Bank, entworfen von dem amerikanischen Architekten Frank Gehry, unspektakulär. Am Brandenburger Tor herrschen strengste Baugesetze. Umso größer kann, wie beim Gedichtschreiben in einer traditionellen Form, die Verblüffung sein.
Rötlich-beiger Sandstein, hohe Fenster, tonnenschwere Türen aus schusssicherem Glas. Man tritt durch die Tür – in eine Amöbe.
Sie schwebt in der Mitte des Innenraums. Eine große, angedeutet runde, gewellte, asymmetrische Hohlform, gemacht aus Zedernholz, beschichtet mit glänzendem Stahl, schräg nach vorn geöffnet: der Konferenzsaal der Bank. Sein Boden ist zugleich die Decke des darunter liegenden, plüschroten Ballsaals. Hinter der Amöbe, dieser den Innenraum der Bank füllenden, begehbaren Skulptur, liegen Wohnungen. Falls man sich hier ansiedeln wollte, wohnen wollte im zerkreuzten geschäftigen Raum des neuen Berlin zwischen Fake-Adlon, der Hochsicherheit der Amerikanischen Botschaft, dem Holocaustdenkmal, das sich unter dem Erdboden fortsetzt und so sehr (sehr kommt von „verletzt“) aus ihm ragt, und dem völlig verknipsten Brandenburger Tor, dem meistfotografierten Gestänge jener Stadt, die seit den 90er Jahren entsteht.
Ahornblatt
Die Großgaststätte Ahornblatt in Berlin-Mitte wurde als gesellschaftliches Zentrum für das neu gestaltete Wohngebiet Fischerinsel 1973 errichtet. Im Gebäude waren eine Selbstbedienungsgaststätte mit 880 Plätzen für das DDR-Bauministerium sowie für Beschäftigte nahegelegener Dienststellen und eine Ladenpassage untergebracht. Der Name „Ahornblatt“ ergab sich aus der blattähnlichen, nach außen gekrümmten Form des Daches. Nach der Wende wurde das Gebäude unter dem Namen Exit als Diskothek genutzt. Später stand das Ahornblatt leer. Trotz starken Protestes erfolgte der Abriss des Ahornblattes im Jahre 2000.
WebseiteWohnen
Im Englischen heißt ‚wohnen’ einfach ‚living’, wir aber machen einen Unterschied zwischen ‚leben’ und ‚wohnen’. Doch wie?
Sich in Beziehung setzen, bleiben, erinnern, also an einem Ort leben und zu ihm zurückkehren – all dies könnte ‚wohnen’ sein. Einen Raum schaffen durch Bewohnen: verändern, was man vorfindet, es anwärmen, sich austauschen damit. Innen, in einem Haus, und außen, in einer Stadt.
„Ich wohne in Berlin“.
Für mich bedeutet dies, wenigstens hier und dort zu wissen, wie eine Straßenecke, ein Laden, ein Weg früher aussahen. Etwa dieses schmale Bedauern in den Schultern zu spüren, wenn ich, mit dem Fahrrad die Leipziger Straße entlangholpernd (tiefe Pfützen, Busse, dichter Verkehr), an das Ahornblatt denke, den eingeschossigen Schalenbau einer SB-Gaststätte auf der Fischerinsel, umgeben von sechs Wohnhochhäusern und zahlreichen Ministerien. Versorgung im spitzen Winkel, gekrönt von einem Dach aus fünf hyperbolischen Paraboloiden, sozusagen als Blattspitzen. Entstanden “durch das starre Schieben einer Parabel entlang einer anderen“. Täglich mehr als 5000 Essensportionen, in den 80ern um ein Schwimmbad erweitert. Als ganz blau habe ich es in Erinnerung. Damals wohnte ich in der Käthe-Niederkirchner-Straße. Ich kannte Straßen, die nach Musikern, Singvögeln oder Pflanzen hießen, nie zuvor hatte ich in einer gewohnt, die nach einer Kampfbomberin benannt war, und nie zuvor hatte eine Bäckersfrau so lange gebraucht, bis sie unseren Morgengruß erwiderte – ein Jahr schwieg sie beharrlich, und die Croissants waren, kamen wir, meist aus.
Es gibt Texte, die ich ohne Berlin und das verschwundene Berlin nie hätte schreiben können, weil man ihre Atmosphären weder träumt noch erfindet, sondern wahrnimmt und übersetzt. Die ersten drei Erzählungen des Bandes Hot Dogs zählen zu ihnen, aber auch das Thema des Romans Mitgift wäre mir ohne Berlin nicht zugekommen.
Der Ort, an dem ich wohne, wirkt auf Texte aber auch dadurch, wie viel Raum er anderem zugesteht. Berlin ist großzügig, das mag mit seiner eigenen Schichtigkeit und Löchrigkeit zu tun haben. Es ist eine Stadt, die der Vorstellung fremder Räume Raum einräumt – sie in sich einsickern lässt. Es erlaubt wegzugehen, während man da ist, eine nomadische Stadt, eine Stadt, die auf dem Fleck nomadisiert, und manchmal glaube ich, sie zu hören im Summen etwa der Straßenbahn oder in einem Hauseingang, darin schwingt ein Grundton, den die Menschen in dieser Stadt machen, in Berlins Räumen, auf den zu breiten Straßen, auf den inzwischen geölten Schienen, während sie sich umsehen mit ihren Augen aus Irgendwo.
Zwei Rätsel
Tonnenschwere Abrissbirnen schwangen in die Fassade, es donnerte. Wäre eine der Birnen in die Spree gefallen, wäre der Fluss übergelaufen, vielleicht wollte man schnell sein mit dem Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten, gab es Asbest? (und man riss so ab: Wolken von Staub), vielleicht wollte man Fakten schaffen. Scheinwerfer brannten.
Vor einer Fassade mit Einschusslöchern aus dem 2. Weltkrieg meinte ein Freund, bei ihnen in Buenos Aires sehe es genauso aus, während ein Bekannter aus Australien lachte, wir gingen über die Brache am Hauptbahnhof, so etwas gebe es doch gar nicht, einen Hauptbahnhof inmitten von nichts. Am besten aber gefiel ihm „the pig“.
Jeder, der auch nur einmal zwischen Tiergarten und Zoo S-Bahn gefahren ist, weiß, was ich meine. Das saftig blaue Haus steht am Ufer des Landwehrkanals, auf Stelzen, aus seinem höchsten Stock aber wölbt sich ein dickes rosa Rohr, das sich zu einem mächtigen, quergelegten U-Bogen ausstülpt und knapp über dem Wasserspiegel wieder in die Fassade mündet. Der Australier war enttäuscht, als er hörte, dass das nicht die Architektur des neuen Berlin sei, sondern das Institut für Wasser- und Schifffahrtstechnik der TU Berlin. 70er Jahre. Im schweinefarbenen Umlaufrohr fließt der Landwehrkanal zu Mess- und Forschungszwecken für eine Weile aufwärts. Immer, wenn ich vorbei fahre, muss ich an Paul Celans Gedicht Du liegst im großen Gelausche denken, der roten Äpfelstaken wegen, des Kanals wegen, Rosa Luxemburgs wegen. Einmal fließt das Wasser gegen die Schwerkraft. Und das Gedicht erinnert mich daran, wie etwas wirklich gewesen sein muss, bis es sich in einen Text verwandeln kann.
Zweites Hausrätsel: Berlin hat etwas erfunden! Ausgerechnet in Berlin ist eine ganz neue Gattung des extrem umweltschonenden, dabei riesigen Hauses entwickelt und etabliert worden. In dieser Kategorie übertrifft Berlin den Rest der Republik mühelos. Am liebsten stehen diese Häuser zwischen dem Brandenburger Tor und der Siegessäule. Sie sind Hunderte von Metern lang und höher als der Fernsehturm. Man sieht sie nicht und kann sie nicht greifen; ihre Wände bestehen aus Geräusch. Nur einen Boden haben sie, und Menschen – Tausende von Menschen. Mit der Love Parade fing diese Kunst an, die Love Parade brachte Berlin bei, virtuelle Häuser zu bauen, seither verwandelt sich die Straße des 17. Juni immer wieder in ein Gebäude aus Laut, Bewegung und Zeit. Es enthält Riesenräder, Buden, Musik, ist länger als jedes ehemalige und gegenwärtige Auswärtige Amt, trägt zur Pflege auswärtiger und sonstiger Beziehungen bei, kostet wenig, wird durchflutet von Grill- und Toilettengestank. Diese Häuser sind schnell. Nachts fließen Ströme von Lichtern daran hinauf und herab.
Konditorei & Café G.Buchwald
Bartningallee 29
10557 Berlin
Tel: +49 (0)30 - 391 59 31
Montag bis Samstag: 9 - 18 Uhr
Sonn- und Feiertags: 10 - 18 Uhr
Süßes Haus!
Und gleich daneben: diese unglaubliche Permanenz.
In einer Stadt, in der alles dem Veränderungs- und Sanierungswahn unterliegt: dieses Beharrungsvermögen.
Diese absolute Veränderungsresistenz.
Gut, man hat in den letzten Jahren vielleicht zwei neue Gartentische angeschafft. Oder doch nur einen. Es ist in „meinem Berlin“ der einzige Ort, der sich seit 1995 nicht verändert hat. Der einzige, der auch nicht so aussieht, als ob er sich je verändern würde. Und zugleich, vielleicht gerade deswegen, einer der wenigen Orte, der all meine Veränderungen unbeschadet mitgemacht hat.
Was bin ich hier treu!
Natürlich ist es ein Café (höchste Zeit), es liegt an der Spree, nicht weit von der alten West-Akademie der Schönen Künste. Café Buchwald, Spezialist für Baumkuchen seit 1852, Selbstbedienung im Garten. Spatzen, Krümel, am Sonntag auch Gedränge. Ab und an japanische Menschen, einen Zettel mit der Adresse in der Hand. Am besten kommt man im Winter in dieses Wohnzimmercafé avant la lettre, dann lässt die 50er Jahre Einrichtung sich so richtig genießen. Unübertroffen die Tapeten, Tischdecken, Tische, Teppiche, alles original, getaucht ins Dämmerlicht der deutschen „guten Stube“. Unübertroffen aber auch die Kuchen, serviert von Bedienungen in langen lila Schürzen und weißlila gestreiften Westen. Kurzum: ein Hochparterre-Fossil, dunkel, verlockend, mit dem engsten Damenklo der Welt zur automatischen Gewichtskontrolle. Und vorn an der Theke Baumkuchen unterschiedlichster Höhe und Breite, mit oder ohne Schokolade, Schicht um Schicht, mit einem Loch in der Mitte und feinen Buchtungen, kleine Häuser, die man essen kann. Oh, sagt die Japanerin neben mir, und ihr Mund wird rund wie eine Scheibe Bonsaibaumkuchen, mit rotem Guss.
... Ende mit AUSBLICK
In Berlin gelte ich des öfteren als Österreicherin, in Berlin bin ich südlicher als je zuvor, in Berlin habe ich einen anderen Gesichtsausdruck, in Berlin erkennt ein polnischer Kollege meine polnischen Wangenzüge in den ersten drei Sekunden, von Berlin fahre ich ganz geradeaus und flach ans Meer, in Berlin promoviert ein amerikanischer Freund über die neue Architektur, die durch Transparenz Innen und Außen aufheben will, wir lachen über die Anstrengung, in Berlin zu wohnen, und die Bäume rauschen, Platanen, Silberpappeln, Bruchweiden und Felsenbirnen. Seit ein paar Wochen wohne ich mit Blick auf eine Brandwand in bunten Ziegelsteinen, der Putz fehlt, es fehlt auch ein großes Stück Haus. Die nächst größere Straße ist angelegt auf die Marschbreite eines preußischen Regiments, zu DDR-Zeiten wurde sie untertunnelt, damit die Politprominenz schneller nach Wandlitz fahren konnte. Dreht man sich um, sieht man die Spitze des Bunkerhügels im Friedrichshainer Volkspark, vor aufwendig restauriertem Märchenbrunnen spazieren Schlenz- und Altberliner, Gentrification-Berliner, Kinder- und Townhouse-Berliner, die sich bewachen lassen neben einem Grundstück, auf dem die erste „Saalschlacht“ stattfand, einem Gauverwaltungsgebäude der Nazis, Mietshäusern aus den 30er Jahren, auf denen Plaketten der sozialistischen Weltjugendspiele kleben. Kino, zehn Kitas, drei Altenheime. Unter dem Haus, in dem ich jetzt wohne, liegt ein Flugzeug in Bruchstücken, liegen die Reste des Hauses, in das dieses Flugzeug stürzte, wir fanden Geschirrscherben, Ziegel, Asche, Metall, als wir den Garten umgruben.
Berlin ist nicht alt. Es ist dicht, festgetreten, verstürzt, gefurcht. Man kann es lesen, die Brandwand gegenüber, die Form des Hofs, welche Gebäudeteile fehlen, welcher Grund nicht mehr bebaut wird, wie hoch die Bäume ragen, 65 Jahre alt. Wir haben keinen Keller, der Boden hätte ausgesiebt werden müssen, kontaminiert, das wäre zu teuer gewesen, man kann Geschichte nicht wegsieben – das ist Berlin. Das Haus ist neu, aus Holz, gebaut ohne Bauträger, zu mehreren, gemeinsame Flächen, das Dach, der Blick gehören allen, der Garten, die Erde, das verspurte Feld. Auch hier ist es manchmal zu hören, das spezifische Geräusch dieser Stadt, die Ruhe der Hinterhöfe, die Schwärme von Gänsen, die im Oktober nach Süden ziehen, ein Summen, als wären Kabel gespannt durch die Luft, Elektrizität, die Ladungen abgibt aus der Vergangenheit, weil so viel hier geschehen ist, weil man es doch fühlen kann, wie einen Roman, den man vorantreibt, in seine Höhen und Tiefen.
In der Brandwand gegenüber wohnt ein Schwarm wilder Bienen. Mitten in „meinem“ Berlin.

















