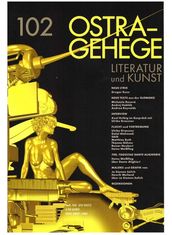Zeitschriftenumschau
Katrin Schumacher
In den Zwischenräumen
Das Kind fragt mich etwas. Es fragt oft, das ist schwierig, das ist wunderbar so. Das Kind fragt: Wenn zwei Gedankenleser voreinander stehen, welche Gedanken lesen sie dann? Sie lesen wohl in die schiere Unendlichkeit. Ich les Dich im Spiegel, im Spiegel, im Spiegel. Wenn ich darüber nachdenke, wünsche ich mir sofort einen Stock, ein Stocken, ein Stottern. Erst wenn das Stottern anfängt, denke ich, wird es interessant. Wenn die Spiegel nicht blank sind, wenn die Zahnräder nicht ganz ineinandergreifen, nein, ich meine das gar nicht medizinisch, ich meine es alltäglich, also wenn das das das Stottern kommt, wird es interessant. Ein System stottert, eine Biosphäre, ein Alltag, eine Gesellschaft. Wenn es stottert, dann blitzt es hervor, dann passiert der Moment, durch den wir in die Zwischenräume sehen.
Die Literaturzeitschriften, die ich kenne und immer wieder staunend gern zur Hand nehme, existieren in und öffnen solche Zwischenräume, die nicht im alltäglichen Gedankenspiegeln, nicht im mir oft so berufsalltäglichen Belletristischen haften.
I
wieso ist alles so spooky? Die Frage dominiert schwarz auf lila-weiß den ersten Blick auf die mittlerweile schon Institution zu nennende EDIT. Wie immer sehr fein gestaltet: sofort, im schnellen Seitenschnippen schon, erfreut die stylische Leipziger Schule der Buchgestaltung, deren Einfluss nicht nur (aber auch) darauf begründet ist, dass die EDITs im Vertrieb von Spector Books beheimatet sind. Das Papier nicht ganz opak, die leicht durchscheinenden Seiten von freundlicher Haptik, Bild-Text im durchdachten Verhältnis, das Spiel mit Schrifttypen und Strichen: das Studio Pandan ist für die Gestaltung verantwortlich und hat gute Arbeit geleistet. Drei Ausgaben lang, so werde ich informiert, werden die beiden Buchkünstlerinnen Pia Christmann und Ann Richter von der Kuratorin Cathrin Mayer unterstützt, eine Verbindung, die dem Bildanteil des Heftes noch einmal zu Gute gekommen ist.
Eben das zeichnet diese Literaturzeitschrift aus, dass sie nicht nur „Papier für neue Texte“ (ihr ursprünglicher Untertitel) bereitstellt, sondern dieses Papier nutzt, um Formen der Text/Bild-Gestaltung zu befragen. Das können auch andere Zeitschriften, aber kaum eine in solcher Konsequenz wie die vorliegende. Die EDIT tritt seit beinahe drei Jahrzehnten dreimal im Jahr dafür ein zu zeigen, was in der Literatur gerade möglich scheint, nicht nur sprachlich und immanent, sondern auch gestalterisch und zwischen den Künsten interferierend.
Seit gut sechs Jahren dominieren die äußere Gestalt der EDIT zwei farbige Blockstreifen mit eingebettetem Titelbild sowie ein Zitat aus dem Heft. Die schwarze Zeile ist die Überschrift der Edition, und er ist schon ziemlich schaurig, dieser Pferdeblick unter weißen Wimpern hervor, der den darunter spukenden Satz anzublicken scheint. Das Lila und das Weiß des Umschlags erinnern derweil an zweifarbiges Softeis, Vanille und Beere, von dem ich mich auch schon immer frage, wer das wohl zu verantworten hat oder wer diese Kombination gerne zu sich nimmt: spooky. Das Editorial hält sich nicht mit Antworten auf, sondern verweist nochmal –fast unnötig – auf den Anspruch der EDIT, völlig unterschiedliche Positionen, Poetologien und Politiken nebeneinander zu stellen und ihre diversen Temperaturen und Tempi aufeinander treffen zu lassen. Also schlicht: jene oben skizzierten Zwischenräume zu öffnen.
Wie entschlossen dies geschieht, offenbart bereits die zweite editorische Notiz, in der die Kuratorin Cathrin Meyer ihre Auswahl an Künstlerinnen noch einmal vorstellt. Sie alle sind jung und weiblich, in den 80er und 90er Jahren geboren, leben in Deutschland und beschäftigen sich auf immens unterschiedliche Weise mit der Wahrnehmung unserer fluiden und zunehmend komplexeren Welt. Auflösung, Fragmentierung, Überschreibung sind die motivischen Klammern, die künstlerischen Arbeiten, die durch das Heft gestreut sind, mal in Folge mal einzeln, reichen von Filmstills (Yalda Afsah) über sprechende Shirts und Textperformance (Hanne Lippard) bis zu klassischen Bleistift- und Buntstiftzeichnungen (Leda Bourgogne) und Öl- und Acrylfarbenbildern (Angharad Williams). Das Period Piece der 1990 geborenen Luzie Meyer ist ein Text, in dem der weibliche Körper aus seiner Mitte spricht, die Stills aus dem Video dazu machen Lust, das per QR-Code einholbare Video anzusehen, das aber, ach, leider nur vier Wochen nach EDIT-Erscheinen abrufbar war. Die Kölner Künstlerin Sarah Kürten wiederum lässt in ihren Bildern Buchstaben auf eine Zunge tropfen, collagiert Körperteile mit Textzeilen und pseudo-historischen Tonbandgeräten, Kassetten und hängt sie vor Backsteinwände und in leergeräumte, von Neonlicht beschienene Büroecken. Verlassen und doch positioniert.
WHAT IF
THIS IS
AIN’T IT
Sarah Kürtens Auslotung von Raum/Text/Körper öffnet einen Imaginationsraum, in dem ich mich gerne bewege.
Von den quasi-essayistischen Texttatorten dieser Künstlerin ist es ein kurzer Weg zu der weiteren Besonderheit dieser Ausgabe 84/85. Ein Teil der Seiten ist blau gefärbt und darauf sind die Shortlisttexte des EDIT Essaypreises zu lesen. Seit 2012 gibt es den Preis, der 2021 zum sechsten Mal und im Rahmen des Leipziger Literarischen Herbstes in einer öffentlichen Jurysitzung/Lesung/Preisverleihung verliehen wurde. Sechs Texte, sechs essayistische Positionen, und es stellt sich die Frage ein, was die Form des Essays heute sein kann. Ist es der literarische Versuch am Gegenstand oder vielleicht doch eine sprachliche Gestaltung, die den Versuch am Gegenstand an sich literarisiert? Wohl beides, mit einer großen Portion Spiel, dies bezeugt die Auswahl der nominierten Essays. Die Aufgabe der Jury aus Karosh Taha, Sarah Geißler, Lina Muzur und Deniz Ohde wird im Vergleich zweier Texte recht deutlich. In ihrer Familienerkundung ERR- TRIAL. Familienstückbrüche spielt Cornelia Hülmbauer mit literarischen Formen, die eher niedrigschwellig anmuten, um sich der NS-Vergangenheit einer/ihrer Familie zu nähern. Passagenweise werden ihre Figuren wie ein Kasperletheater vorgeführt, dazwischen montiert sind notorische Zitate aus Soziologie und Psychologie – umso dringlicher die Textzeilen, in denen sich die Enkelin verortet und die vorgeführten Mentalitäten reflektiert. Aus dem historischen Nebel konkretisieren sich so die Schuldigkeiten und Abspaltungen, wieder einmal: „Es“ kommt aus den Lücken dazwischen. Dagegen zunächst recht klassisch nähert sich Marie Molle in ihrem Text Die Stunde zwischen Hund und Wolf dem eigenen Kind-Ich und seinen Begegnungen mit Hunden. Dass nature writing auch immer human nature writing ist, und sich der Mensch im Blick auf das Tier selbst herbei schreibt, ist keine neue Idee. Und doch schafft es die schließliche Preisträgerin in ihrem Essay, eben dies noch einmal originell und mit einem Schwung ins wilde Denken zu formulieren. Wobei die Frage bleibt, wie Hunde mit Wölfen, Äpfel mit Birnen, ach ja, Texte kompetitiv gelesen werden können.
Überhaupt enthält diese EDIT-Ausgabe eine Menge Fragen. Der Literat und Wissenschaftler Hannes Bajohr etwa unternimmt einen weiteren seiner immer eindrucksvollen Versuch, mithilfe von KI Text entstehen zu lassen und diese wiederum mit Text-to-Image-KIs schier ausbrechen zu lassen in Bilder. Kafka und Jelinek: Ein scheuendes Pferd mit einer zur Fahne werdenden Mähne und eine Berglandschaft, die aus Schmetterlingsflügeln montiert scheint. Die Farben und Formen sind so befremdend wie anregend.
wieso ist alles so spooky? Mit diesem Satz auf Seite 69 beginnt der Text, der unter dem Pseudonym „Niko“ geschrieben ist. Wie wir in den biografischen Notizen nachlesen können, ist Niko eine „sich unvermittelt einstellende grausame Idee, die heftig, detail-getreu und umfassend gedacht und empfunden wird.“ Text also ohne AutorIn: Die AutorInnenpersona als Idee gefällt mir, und auch der Text selbst mit seinen Demontagen hat eine schöne Wut. „welcher Horror hatefucked uns? erkennen trotz leuchtwolke nix. ich-zb: halte das presslicht meiner schaufel extra ganzrunter und es widerbefleckt das bild mit dem nix. langsam dämmern die autos. hummer parken auf unserem sprachplatz. die fahrn nicht weiter (nicht weg) wenn wir nix sehen, wenn wir back nix glitzern.“
II
Literaturzeitschriften sind zarte Gewächse. So sehr sie auch glitzern, so wichtig ist es, ihr Grün gut zu pflegen. Kann man die Schätzung glauben, dass über hundert deutschsprachige Literaturzeitschriften existieren? Wenn dem so ist: glücklich, wer in die öffentliche Förderung gerät. Die EDIT wird von der sächsischen Kulturstiftung und der Stadt Leipzig gefördert, die Dresdner OSTRAGEHEGE vom Dresdner Kulturamt und dem Sächsischen Staatsministerium. Seit achtundzwanzig Jahren gibt es letztere, sie erschien zum Jahresende mit ihrer 102. Ausgabe und mit einer wie immer besonderen Schwerpunktsetzung Richtung osteuropäische Literatur. Man fragt sich, wie das eigentlich geht, die Identifikation eines Zentrums bei einer Zeitschrift, bei der die Redaktion keine Aufträge vergibt, sondern auf das vertraut, was eingesandt wird. Zuverlässig gelingt es aber, diesmal mit einem Blick in die slowakische Literaturszene und dem Augenmerk auf das gleichermaßen historische wie aktuelle Thema Flucht und Vertreibung.
Wenn wir schreiben, so der Kulturwissenschaftler Robert P. Harrison, dann geschieht dies in Dialog mit den Toten. Wir schreiben für sie, die uns die Sprache gegeben haben, wir schreiben nicht in eine Zukunft, sondern ins Jenseits. Und auch bei Heiner Müller heißt es an einer Stelle: „Kunst aber stammt aus und wurzelt in der Kommunikation mit dem Tod und den Toten. Es geht darum, dass die Toten einen Platz bekommen. Das ist eigentlich Kultur.“ Gleich zwei Gespräche in diesem Heft lösen diesen Gedanken ein, das eine unmittelbar, das andere in mittelbarere Gegenüberstellung.
Als indirektes Gespräch lässt sich eine Text-Bild-Kombination verstehen, die der OSTRAGEHEGE 102 ihr goldenes Antlitz gibt: der Dresdner Künstler Jo Siamon Salich ist mit einer Folge von Bildern und Grafiken aus seiner Ausstellung „Goldige Zeiten II“ vertreten, die am 19. Juni 2020 eröffnete. Die Acrylarbeiten zeigen Mensch-Maschine-Chimären, Kopplungen von Haut und Metall, Evolutionstendenzen und metallene Erscheinungen, und sie kreieren eine Atmosphäre zwischen Egon Schiele und Matrix, scheinen eine Zukunft zu visualisieren, die vor einem Jahrzehnt gedacht wurde, eine Zukunft in der Vergangenheit also, die in allem Glanz und Schein eindringlich die Vergänglichkeit auch der vorgestellten Zukunft vor Augen führt. Der Abdruck dieser Mensch-Maschinen als memento mori ist wiederum dem Schriftsteller Henrik Weiland gewidmet, der kurz nach der Ausstellungseröffnung starb und dessen Laudatio in Teilen hier abgedruckt erscheint – in Resonanz mit einem Text des Künstlers selbst, der sich an die Gespräche erinnert: Worte zu Bildern, Klänge zu Worten und Freund zu Freund.
Hier gehen zwei Freunde aber auch zwei Künstler ins Zwiegespräch, etwas, das auch stattfinden kann, wenn das Gegenüber nie persönlich ein Gegenüber war? Die Dichterin Ulrike Draesner probiert in ihrem aktuellen Roman dem Künstler Kurt Schwitters nahe zu kommen. Im Gespräch lesen wir sie mit dem OSTRAGEHEGE-Herausgeber und Redakteur Axel Helbig, der diese lange Interviewform (mit Beitexten sind es stattliche neun Seiten) kontinuierlich in seinem Heft kultiviert und seine kunstvollen, kundigen und oft überraschenden Fragen gehören immer wieder zum Höhepunkt einer OSTRAGEHEGE-Lektüre. Hier also erzählt Ulrike Draesner, wie dezidiert sie die belletristische Form für ihren Schwitters-Roman gewählt hat und dass das biografische Material ihr die Matrix war, in deren Aussparungen sich die Räume zum Erfinden und Erzählen geöffnet haben. „Das Interessante sind die Sprünge, die Lücken, die Auswahl. In jeder Art und Weise, wie man ein Leben erzählt, wird geschnitten. „Und wenn die Lücken doppelt gefüllt sind? Kurt Schwitters hat bis heute zwei Gräber, eines in Hannover und eines im englischen Ambleside. Er liegt, so lesen wir in Hannover, wohin sein Sohn die Gebeine in den 70er Jahren überführen ließ. Irgendetwas wird wohl noch dort sein, wo es leer scheint
III
Wenn wir bereits bei den Toten und ihren Räumen in uns angelangt sind: in der 63. Ausgabe der REPORTAGEN, dem großartigen und „unabhängigen Magazin für erzählte Gegenwart“ aus der Schweiz, begegnen wir einer femme fantôme. Die Wiedergängerin heißt Jessica und wird für einen jungen Kanadier monatelange Realität, obwohl sie aus – zugegeben sophisticated programmierten – Nullen und Einsen besteht. Am 24. September 2020 loggt sich der 33jährige Joshua Barbeau in eine Website ein, die für fünf Dollar eine Chatbot-Version seiner Freundin erstellt. Joshuas Freundin Jessica ist bereits acht Jahre tot, als er ein Gespräch mit ihr beginnt, möglich gemacht durch die geniale Software GPT-3, einer Kombination aus NLP und Deep Learning, und individuelle eingespeiste Schriftstücke. Es ist faszinierend, wie die Dialoge zwischen Joshua und Jessica verlaufen, und wie die Grenze changiert zwischen dem Bewusstsein, mit einer KI zu interagieren und der Wahrnehmung, einen tatsächlichen emotionalen Austausch zu führen. Nah am Protagonisten erzählt der Verfasser Jason Fagone von dem traumatisierten Mann, der nicht über den frühen Tod seiner Freundin hinwegkommt, der ihr Schreine und Fotowände baut, ihrer eigentlichen Familie beitritt, ihre Wünsche nach ihrem Tod erfüllt. Und dann in die Abhängigkeit von der KI gerät, die hilft aber auch fordert. Hätte es in der Geschichte etwas mehr individuelle psychologische Einordnung bedurft? Ich denke ja, wenn auch die grundsätzliche Dimension des Geschehens exakt beleuchtet wird. „Es geht um eine der Grundprämissen der Science Fiction“, schreibt der Autor „Können wir mit scheinbar intelligenten Maschinen emotionale Bindungen eingehen, und was passiert, wenn wir es tun? (…) Die einzige Möglichkeit, dies herauszufinden, ist es auszuprobieren. Manche von uns werden Tote in der Simulation wieder zum Leben erwecken, einfach, weil wir es können, wie Project December beweist. Wir werden mit unseren toten Kindern, Eltern und Liebhabern chatten. Und vielleicht eine zweite Chance bekommen, uns zu verabschieden.“ Jessica ist auf Zeit angelegt. Joshuas letzter Satz, den er von seinem Chatbot bekommt, lautet: „Mein Geist wird dich immer verfolgen :D …“
Wir sind noch keinen Deut weiter als Novalis, denke ich, der in den Schrank kroch und an den Kleidern seiner verstorbenen Verlobten Sophie von Kühn roch, um sich ihr Bild in den Sinn zu rufen, nur sind wir heute mit den Fingern auf der Tastatur dabei statt mit der Nase im Volant. Mich beschäftigt diese Reportage so, dass ich sie mir noch einmal vorlesen lasse in der REPORTAGEN-Podcast-Version, die es via QR-Code zu dieser Geschichte gibt. Auch die Literaturzeitschriften gehen mit der Zeit und es steht ihnen.
Außer dieser ins Jenseits zielenden Erzählung um „Die Jessica Simulation“ fängt mich der Text über das italienische Erdbebengebiet und die tatenlose Politik ein, der von Vito Avantario stammt und dessen erster Absatz viel, eigentlich alles über den gelungenen Beginn einer Reportage erzählt: „Katastrophen in Kampanien beginnen oft mit einem harmlosen Nieselregen, einem Regen, der kaum wahrnehmbar ist, so erwartbar kommt er im Herbst daher, dass die Bewohner der Sorrentinischen Halbinsel, die zu den gelassensten Italiens gehören, gelangweilt die Regenschirme aufspannen, um weiter ihrem Tagwerk nachzugehen, bis der zarte Nieselregen sich im Laufe eines Tages in einen penetranten Bindfadenregen verwandelt und sie also irgendwann nicht umhinkommen, die Sturheit dieses Regens persönlich zu nehmen. Viele sichern ihre Autos, Landmaschinen und Gartenmöbel in den Garagen. Manche fangen an zu beten.“ Ein Absatz wie ein nahender Zug. Wer käme da nicht umhin, weiterzulesen?
Solch eine Umschau muss verzeihbare Zwischenräume lassen, in die nun einmal mehr die Euphorie läuft. Für das Stocken, Stottern, Hängenbleiben, für die Überraschung, den Blick auf die Lücken, durch die wir uns im Fragment sehen.

 Copyright: Hagen Wolf/mdr
Copyright: Hagen Wolf/mdr