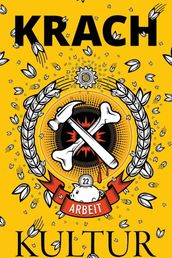Zeitschriftenumschau
Martin Mittelmeier
Ein Blick in Literaturzeitschriften gerade jetzt, ist das wirklich angezeigt? In Ausgaben von Zeitschriften, deren Redaktionsschluss vor dem 24. Februar lag, also vor dem Tag, an dem Putin die Ukraine angriff? Sollte man nicht besser die nächsten Ausgaben abwarten, anhand derer sich dann beobachten und an der eigenen Lektüre erfahren ließe, wie der längere Atem von literarischen und essayistischen Zugriffen die Tickerflut der Tagesereignisse zu ordnen, zu befragen, zu irritieren vermag?
Aber womöglich ist diese Zeitspanne zwischen den so genannten Zeitenwenden und der Möglichkeit, darauf zu reagieren, eine gar nicht so ungünstige für eine Zeitschriftenumschau. Was kann eine gute Zeitschrift an Röntgenblick auf die Gegenwart leisten, was zeigt sich an Brüchen oder Kontinuitäten, bevor sie sich in schrecklicher Aktualität verdichten?
„Wir liefen durch die Straßen, von Trümmern/zu Ruinen“, mit dieser Ballade beginnt die März/April-Ausgabe von Sinn und Form. Der chilenische Schriftsteller Benjamín Labatut spürt in einem nüchtern dunklen Text von 2020, der als Aktualität an der Oberfläche die Pandemie zeitigt, dem Archetyp der leeren Stadt nach. Es ist ein Bild aus den Untiefen unseres kollektiven Gedächtnisses, weil es von Beginn der Zivilisation an den Wahn gab, selbige wieder zugrunde zu richten: die Siedlungen, die gerade anfingen, zu blühen und zu gedeihen, „zu überfallen, zu plündern und zu zerstören“.
Und beim folgenden Essay bestürmen einen sofort von überall her Fragen, die sich, hätte man ihn vor dem 24. Februar gelesen, wohl stark im Hintergrund gehalten hätten. Nils B. Schulz entfaltet die Metapher des „Auf verlorenem Posten kämpfen“, sein theoretischer Bezugsrahmen ist Blumenbergs Konzept der absoluten, der Daseinsmetaphern, die es uns ermöglichen, existenzielle Zustände vor und gegen deren begrifflicher Fixierung gleichsam offen zu halten. Hochreizvoll ist es zu sehen, wie linke und rechte Melancholiker gleichermaßen diese Metapher in Anspruch nehmen, wie Heinrich Heine ebenso wie Ernst Jünger, Slavoj Žižek wie Botho Strauß den „verlorenen Posten“ beziehen. Aber ist gerade diese Metapher nicht ein gutes Beispiel dafür, dass das Konzept der Daseinsmetaphern spätestens in dem Moment fragwürdig wird, wo sich das Bilderfeld mit der Realität kurzschließt? Die Formel funktioniere nur als Metapher, „und zwar weil die Autoren eben nur literarisch in den Kampf ziehen und dieser nicht tödlich ist“, schreibt Schulz. Aber gerät dieses „nur literarisch“ nicht immens unter Druck, wenn die Frage, ob ein Posten verloren ist wie es die vorherrschende Meinung in den ersten Tagen des Putin`schen Angriffs war, zu Konsequenzen von militärischer Unterstützung führt, also direkt zu außerliterarischen Fragen nach dem Ausmaß von Tödlichkeit? So wie mein Benutzen des Wortes „bestürmen“ ein paar Sätze zuvor vor einiger Zeit nur ein mäßig originelles Sprachbild gewesen wäre. Jetzt aber, wo der Sturm auf Stellungen täglich benutzter Ausdruck ist, mindestens Gedankenlosigkeit ist.
Aber der letzte Beitrag in der Doppelausgabe von die horen zeigt, dass auch das ein naiver Gedanke ist: als wäre mit Putins Krieg plötzlich ein größeres Ausmaß von Gewalt und imperialem Anspruch in der Welt, das die Sprache stärker bedrängt als vorher. Viktor Martinowitsch erinnert uns am Ende der horen daran, dass Putins Wahn den der anderen Diktatoren nicht überschreiben sollte: „Früher einmal, vor dem Jahr 2020, war ich ein bekannter belarussischer Schriftsteller, bei dessen Signierstunden die Menschen Schlange standen“, so stellt sich Martinowitsch vor. Aber nun ist er ein Namenloser, seines Betätigungsfeldes beraubt, weil alle Medien, in denen er vorkommen könnte, geschlossen wurden und deren Betreiber verhaftet. „Meine werten Leserinnen und Leser, bitte vergessen Sie nicht, dass es dieses Land einmal gegeben hat, die Republik Belarus. Mit Theater, Malerei und – sogar mit Literatur. Sollten Sie das je vergessen, dann werden wir endgültig verschwinden.“ Das ist der letzte Satz seines Textes, das ist der letzte Satz der Ausgabe der horen zum Politischen in der Literatur.
Eine Zeitschrift brauche eine Tendenz, schrieb T.S. Eliot 1926 als Herausgeber der Zeitschrift The Criterion, aus der das aktuelle Schreibheft einige Beiträge versammelt. Und eben die programmatische Selbstvergewisserung Eliots, gefolgt von den „Letzten Worten“, der Begründung der Einstellung der Zeitschrift 1939. Ein Programm wäre zu festlegend, wäre schnell zu sektiererisch. Eliot möchte mit seiner Zeitschrift stattdessen eine „Tendenz“ erreichen: eine Form von Zusammenhalt, die den Charakter einer Zeitschrift bilde, die aber zugleich Offenheit ermögliche – die Abweichendes zulasse, in der Ein- und Widersprüche statthaben können.
Die Zeitschrift Krachkultur trägt ihre Tendenz im Namen und stellt wie immer ihr Heft unter ein Thema, diesmal: Arbeit. Glücklicherweise wird die Erwartung, die diese Kombination nähren könnte, enttäuscht. Kaum lautstarke, vermeintlich unverfälschte Einblicke in prekäre, abgerockte, zu beklagende und zu bekämpfende Arbeitsformen und -welten. Das auf 272 Seiten schon auch. Aber eröffnet wird der Band von der amerikanischen Autorin Garielle Lutz, die in kurzen erzählerischen Häppchen den Irrsinn moderner Arbeits- und Lebenswelten in Sprachirritation übersetzt. Das dann wiederum ins Deutsche zu übersetzen, ist eine Herausforderung, von der der Übersetzer Christophe Fricker im Anschluss berichtet. Sprachfloskeln vergrößern sich, wenn sie minimal verfälscht oder zu wörtlich genommen werden, zu Alltagsabsurditäten. Das klingt dann in etwa so: „I concerned one of the local woman“, „I brought to an end a period of clandestine gender“, „I think I gulped around my food“ - eine Gratwanderung, diese feinen Verschiebungen das Alltagsgerüst einer anderen Sprache infizieren zu lassen. Und man könnte endlos diskutieren, ob das beispielsweise mit „ich betraf jüngst einer der Frauen hier im Büro“, „ich beendete eine Zeit der Geschlechtsverborgenheit“, „ich umschluckte mein Essen wohl“ schon bestmöglich gelungen ist. Bei vollem Tageslicht geschickt zu scheitern, wie es im Text heißt, ist wohl nicht die schlechteste Empfehlung für die übersetzerische Arbeit an einem solchen Text.
Das Schreibheft lädt ein zu einer Diskussion dieser Art, zu einem Übersetzerfest anlässlich des im Oktober bevorstehenden 100-jährigen Jubiläums der Veröffentlichung von T. S. Eliots The Waste Land. Anja Utler, Yevgeniy Breyger, Esther Kinsky, Rainer G. Schmidt, Rike Scheffler und Johannes Ungelenk übersetzen jeweils den ersten Teil von Eliots Gedicht, The Burial of the Dead (im Anschluss bietet Frank Witzel dann die Art von Übersetzung, die man gemeinhin Lesen nennt).
Und da ist er dann wieder: der Archetyp von der „Unwirklichen (bzw. „irren“) Stadt“, die nur deswegen nicht leer ist, weil die „Masse“ (Breyger), die über die London Bridge strömt, aus Toten besteht. „so viele hat der Tod geholt, kaum denkbar so viele“ (Utler).
Und erneut bietet sich ein Beispiel dafür, wie sich die Rezeption verändert, wenn sich ein Bild mit Aktualität verwickelt, in diesem Fall mit den Szenen der ukrainischen Frauen, die den russischen Soldaten Keime geben, damit wenigstens etwas wächst, wenn sie sterben. „Die Leiche, die du gesetzt letztes Jahr in deinem Garten/Ist sie schon ausgeschlagen? Wird sie blüh’n dies Jahr“ (Ungelenk), heißt es in The Waste Land.
Eine Zeitschrift brauche eine Tendenz, aber Tendenz bedeute eben gerade auch Offenheit, die Ermöglichung widerstreitender Haltungen. Ein probates Mittel, um diese Offenheit zu gewährleisten, ist, ganze Sektionen einer Zeitschrift von Beiträgern betreuen zu lassen, sozusagen die Herausgeberfunktion zu vervielfältigen. Nach der Sektion zu T. S. Eliot, die der Schreibheft-Herausgeber Norbert Wehr mit Gerd Schäfer kuratiert hat, übergibt er den Staffelstab des Arrangierens an Maximilian Gilleßen und Ernest Wichner, die sich mit dem Detektiv des menschlichen Bewußtseins (Patti Smith), René Daumal, und der Bukarester Surrealisten-Szenerie jeweils eines speziellen Moments der europäischen Avantgarde vor und während des II. Weltkriegs annehmen. So organisiert das Schreibheft eine Reise vom Waste Land zu den bloodlands: Gerade noch an der Sorbonne mit den Pariser Surrealisten unterwegs gewesen, „um nun auf dem Rücken eines Pferdes in die Ukraine einzureiten“ – so beschreibt es einer der Bukarester Surrealisten, Gellu Naum, der 1941 als Teil des rumänischen Heeres in den Krieg ziehen musste.
Die Ausgabe der horen geht unter anderem mit diesem Mittel der Herausgebervervielfältigung das Problem an, das sie sich mit dem Thema Das Politische der Literatur selbst gestellt hat. Denn hat sich nicht allein der Begriff des Politischen derart aufgesplittert, dass es notwendigerweise verkürzend sein muss, ihn in einer Zeitschriftenausgabe versammelt zu kriegen wollen? Programm statt Tendenz in der Terminologie Eliots? Also werden auch hier Sektionsherausgeber beauftragt, Gunther Geltinger versammelt Texte zu queeren Positionen, Tom Schulz zu politischer Lyrik. Ganz grundsätzlich arbeitet die Ausgabe zum Politischen der horen mit einer Politik der Vervielfältigung, mit einer wilden Mischung der Formen. Es gibt Fotostrecken von Rolf Nobel, traurig-komische Einblicke in sein Projekt eines Deutschland-Puzzle oder in seine Porträts von Kohleminenarbeitern, Seacoal- und Seetangsammlern. Es gibt Interviews, Dokumentationen von Gesprächsrunden, Bewerbungsschriften für Professuren an Schreibinstituten, thematisch gegliederte Abschnitte (Flucht, Vertreibung, Zurückweisung), formal gegliederte (internationale politische Literatur) und solche, die sich den subversiven stilistischen Techniken einer bestimmten Autorin widmen: Ilse Aichingers ständiges Befragen der Selbstverständlichkeit der Sprache, ihre „Skepsis gegen das Palaver des vollmundigen Erzählens“ (Teresa Präauer), Herta Müllers Collagen. Die Frage nach dem Politischen wuchert zwangsläufig, sie wuchert so stark, dass aus der Ausgabe der horen zum Politischen in der Literatur eine zweite herausgewachsen ist, umfangreicher als die erste.
Tendenz statt Programm, Offenheit statt Sektierertum – es gibt ein weiteres Instrument, das die Offenheit zumindest begünstigt: das Ausnutzen von Gelegenheiten. Sinn und Form bringt in der aktuellen wie schon in der vorangegangenen Ausgabe einen Briefwechsel von Theodor W. Adorno, diesmal mit der Schauspielerin und Sängerin, Kurt Weill-Interpretin und -Witwe Lotte Lenya. Ein Briefwechsel aus dem Archiv der Akademie der Künste, in der auch Sinn und Form beheimatet ist. Was Jens Rosteck zur Einleitung in die Briefe erzählt, reißt viel mehr an Geschichte und Geschichten auf, als es die Briefe selbst können: Die unterschiedlichen Rezeptionsweisen des „deutschen“ und des „amerikanischen“ Kurt Weill. Lenyas ambivalente Rückschau auf die 1920er Jahre, an deren Mythenbildung sie nicht unbeteiligt war. Aber es bedarf nun mal der Briefe, damit die Geschichte um sie herum erzählbar wird.
Einer der Herausgeber der Krachkultur betreibt eine literarische Agentur, was die Zeitschrift auch zu einem schönen Schaufenster für Talente macht. Was aber zugleich die Gefahr einer Übersättigung von Romanauszügen birgt.
Und wenn einem Autor wie Uwe Timm, dessen genuin politische Haltung Maike Albath in ihrer Laudatio entfaltet, der Lessing-Preis der Stadt Hamburg verliehen wird, dann wäre es doch gelacht, wenn Dankesrede samt Laudatio nicht auch noch einen Platz in der Ausgabe der horen fänden. Gelegenheit macht Tendenz im Sinne Eliots. Timms Rede handelt im Übrigen im Kern von Minna von Barnhelm: wie Lessing aus den Verheerungen des Siebenjährigen Krieges die Regungen einer neuen gesellschaftlichen Formation dramatisiert. Und dabei vom Glauben an die vernünftige Entwicklung des Menschengeschlechts nicht lassen will.

 © Marie Kallenberg
© Marie Kallenberg